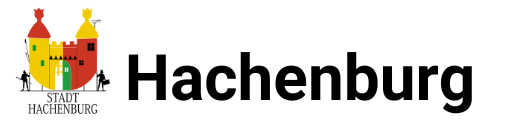Nicht alle für die Geschichte eines Ortes bedeutsamen Ereignisse finden ihren Niederschlag in Akten, Urkunden, Ratsprotokollen oder Presseartikeln. Diese Feststellung gilt insbesondere für den Alltag in der Endphase des verheerenden Zweiten Weltkrieges 1939-1945 sowie in der „Stunde Null“ unserer Demokratie nach der Niederlage des NS-Regimes. Um dem Vergessen des Schicksals von sieben Hachenburger Kriegsopfern entgegenzuwirken bedarf es zeitgenössischer Berichte und Erzählungen. Im Fall der Kinder und Jugendlichen, die am 24. Januar 1946, etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bei einem Munitionsunglück ihr Leben verloren haben, bieten die Schilderungen noch lebender Zeitzeugen den Schlüssel zum Verständnis der dramatischen Geschehnisse. Der sonnige Wintertag des 24. Januar 1946 ist tief in den Erinnerungen von Gisela Weyer, Karl Wilhelm Breidenstein und Karl Ludwig Bonn verwurzelt.
Einen wesentlichen Anstoß zu der Gedenkveranstaltung auf dem Ehrenfriedhof in Hachenburg gab Karl Wilhelm Breidenstein, der auch die Aufstellung einer Gedenktafel für die Opfer des Munitionsunglücks im Stadtrat angeregt hat. Am Freitag, den 24. Januar 2025 gedachten zahlreiche Anwesende den verstorbenen Kindern und Jugendlichen, die der verheerenden Explosion zum Opfer gefallen sind. An eine Einführung in die Thematik durch den Stadtarchivar Dr. Jens Friedhoff, die sich im Wesentlichen auf den Bericht von Karl Wilhelm Breidenstein stützte, schloss sich die Niederlegung eines Kranzes an der Gedenktafel für das Munitionsunglück an. Der Text der Tafel verweist auf das Ereignis, lokalisiert den Ort des Geschehens und nennt die Namen der Opfer: Gerhard Wolfgang Schrupp (geb. 14. Feb. 1937), August Otto Heuzeroth (geb. 22. Nov. 1932), Hans-Kurt Heller (gebt. 27. April 1923), Adolf Haas (geb. 28. Juni 1933), Friedrich Wilhelm Adam (geb. 04. April 1940), Erika Kohlhaas (geb. 27. März 1940) und Hans Schmidt (geb. 14. Feb. 1932). Zahlreiche weitere Kinder erlitten am 24. Januar 1946 schwere Verletzungen. Eine umfassende Berichterstattung in den Medien, wie wir es heute gewöhnt sind, fand zu Beginn des Jahres 1946 nicht statt! Umso wichtiger sind Zeitzeugenberichte, die uns anschaulich an die „Narben“ des verheerenden Zweiten Weltkriegs und dessen Auswirkungen und Folgen in unserer Stadt und in der Region erinnern.
Auf Weisung der französischen Besatzungsbehörden, die rasch die im Westerwald stationieren US-Truppen abgelöst haben, mussten Jugendliche aus Hachenburg Munition aus den umliegenden Wäldern und Feldern zusammentragen. Das Material wurde auf einer unbebauten Wiese unweit der Siedlung Dehlinger Weg gelagert. Das Gelände diente den Kindern als beliebter Spielplatz. Am Unglückstag hielten sich etwa 20 Kinder und Jugendliche auf dem Areal auf. „Ein etwas Größerer, der bereits als Flak-Helfer eingesetzt war, beobachtete“, wie dem Bericht von Karl Wilhelm Breidenstein zu entnehmen ist, „wie ein Kind mit einer Handgranate spielte, und sah, dass es diese Granate abgezogen hatte. Er riss dem Kind die Granate aus der Hand und warf sie weg – ausgerechnet in den Haufen mit der Munition. Alles flog in die Luft“. Ein unglaublich „lauter Knall“ war selbst in Hachenburg wahrzunehmen, wo Breidenstein zu dieser Zeit im Garten seines Geburtshauses, des heutigen Vogtshofs, spielte. Zu den Opfern der Explosion gehörte auch sein Schulkamerad und Banknachbar Gerhard Schrupp. Die Dramatik des Ereignisses wurde den Kindern erst später klar. An der Gedenkveranstaltung nahmen auch Karl Ludwig Bonn und Gisela Weyer teil, die als Kinder ebenfalls Zeitzeugen waren. Gisela Weyer schilderte im Anschluss an die Kranzniederlegung, dass sie an dem Schicksalstag von ihren beiden Cousins ermuntert worden war, sie zu dem „Spielplatz“ am Dehlinger Weg zu begleiten. Ihre Mutter, die sie beauftragt hatte, Milch an Nachbarn zu verteilen, ließ sie jedoch nicht gehen. Beide Cousins zählten zu den Opfern.
Als wichtiges Moment einer „lebendigen Erinnerungskultur“ wird die Veranstaltung den Anwesenden und insbesondere den Zeitzeugen, verbunden mit persönlichen Erinnerungen, noch lange präsent bleiben. Die Dokumentation „schmerzvoller Spuren der Erinnerung“ durch die Veranstaltung sowie die Gedenktafel ist umso wichtiger, zumal das Munitionsunglück vom 24. Januar 1946 in der stadtgeschichtlichen Literatur bislang noch keinen Niederschlag gefunden hat.