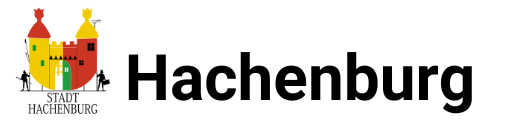Am Montag, den 27. Januar 2025 begab sich eine Gruppe von Studenten der Hochschule der Deutschen Bundesbank auf Schloss Hachenburg auf eine Spurensuche in Hachenburg und Altstadt. Ziel der Aktion war die Reinigung der 2012 und 2013 in Hachenburg und Altstadt verlegten Stolpersteine und das Gedenken an die Opfer des NS-Terrorregimes. Anlass bot die Wiederkehr der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren. Dem Wunsch von Herrn Eike Sandau, der die Aktion ins Leben gerufen und seine Kommilitonen animiert hatte, sich zu beteiligen, folgend, wurde die Studentengruppe von dem Stadtarchivar Dr. Jens Friedhoff begleitet. In der kleinen Dauerausstellung zur Stadtgeschichte (Hachenburg Anno Domini 1314) im Gewölbekeller des Rathauses in der Perlengasse 2 fand eine kurze Einführung in die Thematik „Jüdisches Leben in Hachenburg“ statt. Mehr als historische Fotos und Dokumente bewegen die kurzen biographischen Notizen auf den 44 in Hachenburg und in Altstadt befindlichen Stolpersteinen, die an die Leidenswege der Hachenburger Mitbürger jüdischen Glaubens erinnern. Ein direkter Bezug zu der Gedenkstätte des KZ Auschwitz, wo ca. 1,1 Millionen Opfer ihr Leben lassen mussten, ist dadurch gegeben, dass zehn Personen aus Hachenburg, die den Familien Schönfeld, Weinberg, Friedemann, Löw, Löb, Bär, Liebmann angehörten, dort getötet wurden.
Das Verweilen an den Stolpersteinen bot die Möglichkeit zur Spurensuche in der Hachenburger Innenstadt. Unsere Stadt weist weit mehr als die durch Informationstafeln gekennzeichneten Erinnerungsorte jüdischen Lebens, wie z.B. die Synagoge am Alexanderring oder den Judenfriedhof, auf. So dokumentiert z.B. das gegenüber der Einmündung der Judengasse in die Wilhelmstraße gelegene ehemalige jüdische Kaufhaus Seligmann-Rosenau aus dem Jahr 1906 die Präsenz jüdischer Familien im geschäftigen Leben unserer Stadt in wilhelminischer Zeit. Knapp vier Jahrzehnte nach dem Anwachsen der jüdischen Kultusgemeinde Hachenburg, zu der auch jüdische Familien in den Orten des Umlandes zählten, dem Neubau der Synagoge 1896/97 sowie einem harmonischen Miteinander Angehöriger der christlichen Konfessionen und des mosaischen Glaubens, führten übersteigerter Nationalismus und Rassenwahn in die Katastrophe des Dritten Reiches. Angesichts eines zunehmenden rechtsorientierten Populismus, leidenschaftlich geführten Debatten über Migration oder der Angst vor dem Verlust des nationalen Wohlstandes und des wirtschaftlichen Abstiegs bedarf es der stetigen aktiven Auseinandersetzungen mit dem Unfassbaren: der NS-Diktatur, des Gedenkens an die Opfer des Regimes sowie der Beschäftigung mit der nach der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 massiv vorangetriebenen Manipulation der öffentlichen Meinung durch die ihrer unabhängigen Berichterstattung beraubten Medien in der NS-Zeit.
Sonderführungen zum Thema „Nationalsozialismus“ oder „Jüdisches Leben in Hachenburg“ durch das Stadtarchiv Hachenburg auf Anfrage. Erwerb des H. 10 der Schriften des Stadtarchivs zum „Jüdischen Leben in Hachenburg“ während der Geschäftszeiten der Stadtverwaltung Hachenburg im Rathaus Perlengasse 2.